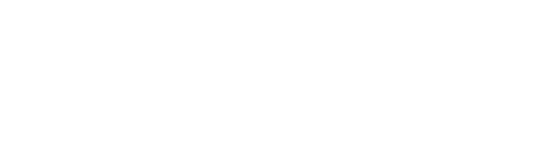Technologie und Bildung. Wie verändert sich der Bildungssektor bis 2030?
Welche Chancen und Herausforderungen sich durch den Einsatz digitaler Technologien ergeben, wie allen Menschen Zugang zu digitalen Inhalten gewährt werden kann und wie diese Inhalte inklusiv und chancengerecht gestaltet werden können, wurde am 16. Mai auf Einladung der Österreichischen UNESCO Kommission in der Kassenhalle der Österreichischen Postsparkasse in Wien diskutiert.
Im Juli 2023 wird der neue UNESCO Weltbildungsbericht präsentiert, der den Einsatz von Technologien in der Bildung zum Schwerpunkt hat. Für die UNESCO ist bei der Auseinandersetzung mit digitalen Technologien ein menschenrechtsbasierter Zugang zentral. Aus diesem Grund wurde bei der Veranstaltung der Österreichischen UNESCO Kommission im Rahmen einer Keynote und von drei Panel-Diskussionen erörtert, wie sich der Bildungssektor durch Technologie verändert.
Die von Anna Goldenberg moderierte Veranstaltung wurde von Claudia Sabine Koch (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung), Martin Fritz, Stephanie Godec und Christine Maaß (Österreichische UNESCO Kommission) eröffnet. Ein Impuls von Kenza Ait Si Abbou Lyadini, Expertin für Künstliche Intelligenz und Robotik, eröffnete die darauffolgenden Diskussionen.
Nationale UNESCO Kommissionen
Die UNESCO sieht für jeden Mitgliedsstaat eine Nationalkommission vor und überträgt diesen die Mitverantwortung für Themen, Programme, Anliegen der UNESCO als Kontaktstelle und Informationsplattform zu fungieren. Das Besondere an der UNESCO-Architektur ist, dass es stets darum geht, Regierungsstellen und die Verwaltung mit den Akteur*innen der Zivil- und Fachgesellschaften im jeweiligen Themenfeld zu vernetzen. Dies geschieht u.a. durch Beiträte, etwa für Transformative Bildung, aber auch die Ethik der künstlichen Intelligenz. „Somit verstehen wir uns als Drehscheibe für Kommunikation, als Initiator*innen von Dialogen“, erklärte Martin Fritz, Generalsekretär der Österreichischen UNESCO Kommission zu Beginn der Veranstaltung.
Ausgangspunkt der beim UNESCO Talk diskutierten Beiträge stellt der im Juli 2023 erscheinende UNESCO-Weltbildungsbericht (Global Education Monitoring Report) dar.
Technische Transformation im Bildungssektor bis 2030
„Was bedeutet der technologische Fortschritt für die Aus- und Weiterbildung und welchen chancengerechten Zugang muss es geben, dass wir von Aus- und Weiterbildung sprechen können? Welchen Zugang muss es geben und in welchen rechtlichen Rahmen muss Aus- und Weiterbildung gegossen werden? Welche Bedingungen braucht es, um überhaupt Zugang zu haben und damit die Agenda 2030 im Bereich Technologie überhaupt umgesetzt werden kann?“, fragte Stephanie Godec vom Fachbereich Bildung der Österreichischen UNESCO Kommission das Publikum.
Christine Maaß, zuständig für den Fachbereich Wissenschaft der Österreichischen UNESCO Kommission, beschäftigt sich aktuell verstärkt mit der Frage, welche Rahmenbedingungen es braucht, um das Potential der Technologien zu entfalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass Grund- und Freiheitsrechte im Bildungskontext und allen anderen gesellschaftlichen Bereichen gewahrt bleiben.
Im Rahmen des UNESCO Talks wurden drei Themen aufgegriffen, die für eine technische Transformation im Bildungssektor bis 2030 unabdingbar sind, um gerechte Zugangsmöglichkeiten und die Wahrung der Menschenrechte zu gewährleisten:
- Panel I: Technologie & chancengerechter Zugang
Margarita Langthaler (Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung), Rania Wazir (leiwand.ai), Walburga Fröhlich (atempo), Maria Blomenhofer (Youth Representative der Österreichischen UNESCO Kommission) - Panel II: Technologie & Aus- und Weiterbildung
Jörg Hofstätter (ovos), Sonia Zaafrani (Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen), Dominic Ellwardt (Youth Representative der Österreichischen UNESCO Kommission), Doris Vickers (VHS Wien | Stabstelle Digitalisierung)
- Panel III: Technologie & Grundrechte
Antonia-Sophie Gallian (Universität Innsbruck | Institut für Theorie und Zukunft des Rechts), Fares Kayali (Universität Wien | Zentrum für Lehrer*innenbildung), Erich Schmid (Österreichischer Behindertenrat), Karoline Moser (Montanuniversität Leoben | Lehrstuhl für Mathematik, Statistik und Geometrie)
Es wurde erörtert, welche Chancen, Privilegien und Probleme Technologie, Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Bildungsbereich mit sich bringen und wie diese technischen Entwicklungen in diesen Bereichen bezüglich Zugänglichkeit, Inklusion, Datenschutz, Cybermobbing etc. in der formalen, non-formalen und informellen Bildung einander unterstützen können. Weiters wurde diskutiert, welche Vernetzung und Zusammenschlüsse zwischen Bildungsinstitutionen, Tech-Unternehmen und Politik nötig sind, damit effiziente und sichere digitale Anwendungen entstehen können.
Wie Wissenstransfer auf internationaler Ebene gefördert werden kann, um die Transformation der Bildung mit Fokus auf Demokratiebildung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung und Global Citizenship Education im Sinne der UNESCO und der 17 Ziele für eine Nachhaltige Entwicklung (SDGs) – leaving no one behind (niemanden zurücklassen) – zu stärken, war ebenso Thema der Diskussion.
Technologie und Grundrechte
Im Panel III ging es in erster Linie darum, wie sich Technologie und Grundrechte vereinbaren lassen. Erich Schmid, Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrates, lieferte für die Vor- und Nachteile von Technologie folgendes Beispiel : „Ich bin blind. Als ich ins Gymnasium ging, gab es für Menschen, die sehen, bereits die ersten Schulbücher. Ich musste mir die Schulbücher der wichtigsten Gegenstände wie Mathematik und Fremdsprachen noch diktieren lassen und abschreiben. Später kamen Schulbücher auch für Menschen mit Blindheit oder mit Vergrößerung für Menschen mit Sehbehinderung auf den Markt, und später die sogenannten digitalen Schulbücher. Wunderbar, es gab wesentlich mehr Angebot. Heute haben wir ein riesiges Angebot, alles auf Webseiten, und jeder Verlag verwendet seine eigene digitale Oberfläche. Das heißt, der zehnjährige Schüler, die zehnjährige Schülerin muss sich mit zig unterschiedlichen Web-Oberflächen auseinandersetzen.“
Technologie könne sehr vieles einfacher machen. Vor allem die Nutzung des Internet sei eine ganz wichtige Sache, erklärte Schmid. „Dank unserer Hilfsmittel kann zum Beispiel künstliche Intelligenz dabei helfen, Internetseiten barrierefreier zu machen. Das ist eine wunderbare Sache.“ Aber wie man am Beispiel der Schulbücher sehen könne, werde es problematisch, wenn nicht der gemeinsame Wille und das Befolgen gegebener Richtlinien dahinter steckt. „Es gibt Web Accessibility Guidelines. Sie müssen aber auch richtig umgesetzt werden.“ Schmid zufolge müsse man darüber hinaus vom medizinischen, defizitorientierten Modell von Behinderung wegkommen.
Die Juristin Antonia-Sophie Gallian erklärte, dass es für Menschen mit Blindheit einen besseren rechtlichen Rahmen für den Zugang zu digitalen Technologien geben müsse. Das Recht schaffe aber lediglich einen Rechtsrahmen.
Man müsse den Unterricht oder Lehreinheiten so aufbauen, dass sie inklusiver sind, betonte Karoline Moser von der Montanuniversität Leoben. „Wir haben ein Schulsystem, das segregative Maßnahmen trifft“, bemerkte Fares Kayali von der Universität Wien. Digitalisierung in der Schule müsse aber für möglichst alle Schüler*innen zugänglich sein. Sie biete jedenfalls die Gelegenheit für individualisiertes, differenziertes Lernen und verbessertes Feedback. „Es gibt einen starken politischen Willen, diese Digitalisierungsthemen zu pushen. Vielleicht gibt es hier die Chance, gleich ein paar andere Dinge mitzunehmen“, so Kayali, der als Beispiel die Förderung offener Lernstrukturen anführte.