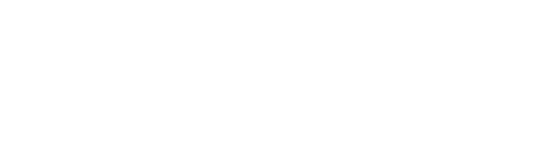Die Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH und die Lebenshilfe Österreich beauftragten das Forschungsbüro queraum. kultur- und sozialforschung mit einer Studie zum Thema „Inklusives Altern. Unterstützung und Begleitung von älteren Menschen mit lebensandauernder intellektueller Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf in Österreich“. Aus gesammelten Daten abgeleitete Handlungsempfehlungen wurden am 7. November 2022 im Rahmen einer Zoom-Session präsentiert.
41 Prozent jener Menschen, die in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe betreut werden, sind mittlerweile älter als 50 Jahre – und die Zahl steigt. Zwar werden deren individuellen Bedürfnisse von den agierenden Mitarbeiter*innen berücksichtigt, sie sind aber weder strukturell, noch systemisch verankert. Bei Menschen mit lebensandauernder intellektueller Behinderung spricht man daher oft von „unsichtbarem Altern.
Neben einer Literaturrecherche und Expert*inneninterviews wurden entsprechende Daten gesammelt und daraus resultierend auch Handlungsempfehlungen für die zukünftige Gestaltung von Angeboten und Dienstleistungen für ältere Menschen mit lebensandauernder intellektueller Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf in Österreich erarbeitet.
Die Autor*innen zeigen auf, dass in den gesetzlichen Regelungen nach wie vor Bilder und Zuschreibungen erzeugt, die sich am medizinischen und nicht am sozialen oder menschenrechtlichen Modell von Behinderung orientieren.
Es habe sich zudem eine starke Kompetenz-Zersplitterung zwischen Bund und den Bundesländern, beispielsweise durch die neun verschiedenen Sozialgesetzgebungen, gezeigt. Die Unterschiede würden Inhalte und Qualität der Leistungen, Angebotsdichte, Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für deren Nutzung (nur teilweiser Rechtsanspruch wie bei Persönlicher Assistenz) beinhalten.
Die Anspruchsberechtigten seien oftmals überfordert, was dazu führen könne, dass Leistungen nicht abgerufen werden. Zudem gebe es zu wenige flexible Dienstleistungen und Angebote, wie z.B. strukturell verankerte Übergangsangebote in Tagesstrukturen für alte Menschen mit Behinderungen und/oder hohem Pflegebedarf. Landesweitgebe es einen mangel an (mobilen) Pflege- und Betreuungsdiensten, interdisziplinären Betreuungssettings und alternativen Wohnformaten.
Die Altersbegrenzung der Persönlichen Assistenz im Beruf, aber auch in der Freizeit – bis zum 65. Lebensjahr – stelle Bezieher*innen im Alter vor besonders schwierigen Herausforderungen. Ohne diese selbstbestimmte Unterstützungsform könnten sich familiäre Abhängigkeitsverhältnisse verstärken. Besonders prekär sei die Situation von alten Menschen mit intellektuellen Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf, wenn sie auf keine eigene Pension zurückgreifen können, was für den Großteil zutreffe. In vielen Fällen schöpfe sich dann das geringe Einkommen aus Sozialhilfeleistungen, etwa Mindestsicherung oder Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension, das mit einer Ausgleichszahlung ergänzt werde. Erschwerend komme hinzu, dass Betroffene kein zusätzliches Einkommen generieren dürfen, was wiederum das Armutsrisiko erhöhe.
Barrieren bei Arbeit und Beschäftigung
Barrieren würden sich für Menschen mit Behinderungen auch im Kontext der Arbeit und Beschäftigung an der Schnittstelle von Länder- und Bundeskompetenzen zeigen. Aufgrund der Kompetenzverteilung würden das Arbeitsrecht und die Sozialversicherung in die Verantwortung des Bundes, die sogenannte „Beschäftigungstherapie“ (auch „Tagesstruktur“ oder „Tageswerkstätte“ genannt) jedoch in die der Länder fallen, was den Übergang von der Beschäftigung in den Arbeitsmarkt deutlich erschwere. Zudem sei die langjährige Forderung der Änderungen des Taschengeldes in ein Gehalt mit sozialrechtlicher Absicherung noch immer nicht umgesetzt worden.
Ein weiteres Problemfeld stelle die mangelnde Datenlage über die tatsächliche Situation von alten Menschen mit intellektuellen Behinderungen und/oder hohem Unterstützungsbedarf in
Österreich dar. Daher sei den Autor*innen zufolge die Erhebung von nach Beeinträchtigung, Alter und Geschlecht aufgeschlüsselten Daten als Grundlage für eine nach der UN-Behidnertenrechtskonvention orientieren Politikgestaltung unerlässlich.
Auch im Rechtssystem würden sich Lücken in der Beurteilung zeigen, so etwa beim Diskriminierungsschutz von älteren/alten Menschen mit intellektuellen Behinderungen und/oder hohem Unterstützungsbedarf. Es brauche eine intersektionale Perspektive, die Ungleichheitskategorien wie Behinderung, Alter und Geschlecht bzw. deren Zusammenwirken ausreichend berücksichtige. Nicht die Gruppenzugehörigkeit, sondern die individuellen Lebensrealitäten sollten für die Gewährleistung der Grund- und Menschenrechte herangezogen werden. Dies wäre eine eine wichtige Voraussetzung für ein Leben in Zufriedenheit und Würde von alten Menschen mit intellektuellen Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf, so die Autor*innen.
Forderungen zur Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderungen an die Politik
Aus der Zivilgesellschaft, den Interessenvertretungen und Einrichtungen der Behindertenhilfe würden seit Jahren wiederholte Forderungen zur Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderungen an die Politik gestellt. Zentrale Punkte dabei seien die Einrichtung eines Inklusionsfonds zur Finanzierung von Maßnahmen an der Schnittstelle von Bundes- und Länderkompetenz, bundeseinheitliche Qualitätsrichtlinien für die Behindertenhilfe und die Einrichtung eines Staatssekretariats für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen im Bundeskanzleramt sowie die Einführung eines persönlichen Budgets.
Zentrale Handlungsempfehlungen
Die Handlungsempfehlungen wurden aus den einzelnen Erhebungsschritten, allen voran aus Fokusgruppengesprächen, Tiefeninterviews, einem inklusiven Workshop und Expert*innen-Interviews abgeleitet. Die darin enthaltenen Aspekte fokussieren auf drei unterschiedlichen Ebenen: Politik und Gesellschaft – Institution – Individuum, wobei diese häufig aufgrund ihrer wechselseitigen Bedingtheit nur in ihrem Zusammenwirken betrachtet werden sollten.
Zahlreiche Empfehlungen bezogen sich auf strukturelle Änderungen in der Politik, aber auch in einrichtungsbezogener Hinsicht. Oberste Ziel der Politikgestaltung und der Behindertenhilfe müsse es sein, ihr Handeln am sozialen und menschenrechtlichen Modell von Behinderung auszurichten, indem Menschen mit Behinderungen als Rechtssubjekte und nicht als bedürftige Hilfsempfänger*innen angesehen werden. Die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen in den Bundesländern müssten harmonisiert und im Sinne eines einheitlichen Sozialbereichs umstrukturiert werden, der sich nicht an Gruppenzugehörigkeiten (Menschen mit Behinderungen, alte Menschen), sondern an individuellen Bedarfen orientiert. Ferner sollten einheitliche Qualitätsstandards in der Behindertenhilfe und Altenpflege und bundesweit persönliche Assistenz für alle Lebensbereiche sowie persönliches Budget eingeführt werden.
Eine ambitioniertere Umsetzung der De-Institutionalisierung mit Sozialraumorientierung und Ausbau von gemeindenahem und unabhängigem Wohnen wurde ebenso empfohlen wie der barrierefreie und qualitätsvolle Zugang zum Gesundheitssystem. Zudem wurde die Früherkennung von demenziellen Erkrankungen durch standardisierte Diagnostikverfahren und gesundheitspräventive Maßnahmen bereits im jungen Alter, inklusive Ernährung und Bewegung als wichtig erachtet.
Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Altenpflege sollten den personenzentrierten Ansatz in ihrer Handlungspraxis ausbauen und flexiblere Strukturen im Wohnen sowie in der Beschäftigung gewährleisten, die einen fließenden Übergang in den „Ruhestand“ ermöglichen.
Das Prinzip der Wahlfreiheit müsse dabei handlungsleitend sein. Die Möglichkeiten der Teilhabe am Leben innerhalb der Einrichtung, aber vor allem außerhalb des Wohnbereiches müssten erweitert werden. Soziale Kontakte, Zugang zu kulturellen und bewegungsorientierten Angeboten, politischen Aktivitäten (beispielsweise Ehrenamt) etc. seien unabdingbar für ein gutes und würdevolles Leben im Alter. Bei altersbedingten Prozessen, wie Erkrankungen, möglichen Mobilitätseinschränkungen bis zum Lebensende bedürfe es nicht nur guter Unterstützung und Pflege, sondern auch Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen. Um ganzheitliche Betreuung und Unterstützung auch im (hohen) Alter gewährleisten zu können, bräuchte es multiprofessionelle Teams und Netzwerkwerke mit externen Dienstleiter*innen, wie Ärzt*innen und Palliativ-Teams.
Der Personalmangel spielte vor allem in der Altenpflege eine große Rolle, wobei dieser coronabedingt mittlerweile auch in der Behindertenhilfe angekommen zu sein scheint. Diesem effektiv zu begegnen, bräuchte es adäquatere Arbeitsbedingungen und eine höhere Entlohnung bzw. mehr Aus- und Fortbildungsplätze für qualifiziertes Personal. Auf gesellschaftlicher Ebene sollten sozialraumorientierte Angebote durch Kooperation mit vor Ort vorhandenen Einrichtungen und Dienstleister*innen ausgebaut und gemeindenahe, inklusive Wohnformen (beispielsweise Mehrgenerationen-WGs) gefördert werden. Zum Abbau von noch immer bestehenden gesellschaftlichen Vorurteilen und Stereotypen gegenüber Menschen mit Behinderungen und insbesondere älteren Menschen mit Behinderungen bedürfe es lokaler und nationaler Sensibilisierungs- und Aufklärungskampagnen und -initiativen.
Auf individueller Ebene der Zielgruppe sei eine Auseinandersetzung mit den Themen Altern, Demenz, Tod und Sterben zentral. Hier brauche es ebenfalls mehr Aufklärungsarbeit in Form von Kursen, Workshops und barrierefreie Informationen. Wichtig sei es darüber hinaus, älteren Menschen mit Behinderungen zwar einerseits viele Angebote zur Teilhabe zu setzen und gleichzeitig dem Bedürfnis nach mehr Ruhe nachzukommen, indem Rückzugsräume geschaffen und ermöglicht werden.
Anna Schachner, Sabine Mandl, Roman Weber, Simeon Breuer und Lea Romm: Inklusives Altern. Unterstützung und Begleitung von älteren Menschen mit lebensandauernder intellektueller Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf in Österreich. 2022
Studie Inklusives Altern (PDF, 5 MB)
Präsentation der Studie „Inklusives Altern“
Dieses Video zeigt die Online-Präsentation der Studie „Inklusives Altern. Unterstützung und Begleitung von älteren Menschen mit lebensandauernder intellektueller Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf in Österreich“. In den ersten 30 Minuten wird die Studie in einfacher Sprache vorgestellt, danach in schwieriger Sprache.
Das Forschungsinstitut querraum.kultur- und sozialforschung wurde mit der Umsetzung der Studie beauftragt, finanziert wurde sie aus Mitteln des Bundesministeriums für Soziales und von der Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH.